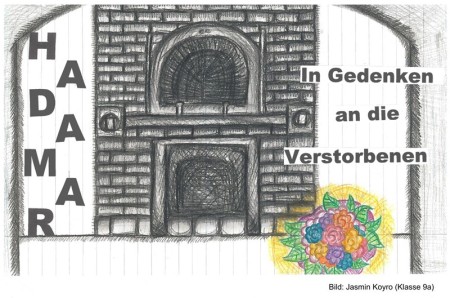
Am 1. Februar 2017 besuchte die Klasse 9a im Rahmen des Geschichtsunterrichts die NS-Gedenkstätte in Hadamar. Zum Gedenken an die Opfer hielten die Schülerinnen und Schüler ihre Eindrücke in Reden, Reportagen und Bildern fest, die im Folgenden auszugsweise vorgestellt werden.
Mein Name ist Paula Bottländer. Ich wurde am 19. Juni 1892 in Amsterdam geboren. Meine Kindheit war zwar nicht immer einfach, doch war sie trotzdem eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Im Alter von 25 Jahren ging ich als Pflegerin nach Gent. Der Krieg hatte begonnen und mich verändert. Ich habe schreckliche Sachen erlebt, aber dies hätte mich in keinster Weise darauf vorbereiten können, was ich später noch erleben werde. Durch meine Aufregung und Überanstrengung bei Fliegerangriffen erlitt ich einen Nervenzusammenbruch mit Krampfanfällen. Das hinderte mich aber nicht daran, 1920 den wundervollsten Mann zu heiraten und ihm nach Hildesheim zu folgen. Am 9. Juni 1925 wurde uns eine Tochter geschenkt, die wir Margot nannten. Nach langer Zeit war mein Leben vollkommen. Dieses geliebte Kind gab mir so viel Glück. Ich dachte, ich könnte wieder so glücklich sein wie früher, jedoch ließ mich der Krieg nicht los. Die epileptischen Anfälle kamen immer wieder und wieder. Seit den 30er Jahren war ich nun in Anstaltsbehandlung. Da sich keine Besserungen zeigten, wurde ich im März 1938 in die Landesheil- und Pflegeanstalt in Hildesheim aufgenommen. Dort konnte mir auch keiner helfen. Ich litt immer noch unter den Folgen des Krieges. In der Anstalt fühlte ich mich nicht wohl. Die Atmosphäre war erdrückend und der Tagesablauf nicht schön. Erneut wurde ich im April 1941 verlegt. Dieses Mal nach Eichberg, aber auch dort sollte ich nicht lange bleiben. Am 9. Mai des gleichen Jahres wurde ich mit 89 weiteren Patienten in einem grauen Bus nach Hadamar gefahren. Das Einzige, was mich an diesem Zeitpunkt noch am Leben hielt, war der Gedanke an meine geliebte Tochter Margot und meinen Mann. In Hadamar angekommen, wurden wir in einen großen Raum mit vielen Betten gebracht. Nacheinander wurden wir aufgerufen und zu einem Arzt gebracht. Die Stimmung im Raum war gedrückt und ich wartete darauf, dran zu kommen. Als ich aufgerufen wurde, untersuchte der Arzt mich und stellte Fragen. Weitere Zeit im Raum mit den Betten verstrich, bis alle Patienten untersucht wurden. Wir wurden aufgefordert zu duschen. Eine enge Treppe hinunter wurden wir in einen Keller geführt. Mir war nicht wohl bei der Sache. Auf der linken Seite lag ein Duschraum. Es war sehr eng, da wir mit knapp 50 Leuten gleichzeitig duschen mussten. Die Türen schlossen sich und ich wartete. Es passierte nichts. Kein Wasser drang von der Decke. Wir wurden langsam unruhig. Von der einen Sekunde auf die andere wurde mir übel. Mein Kopf begann weh zu tun und ich musste mich an der Frau neben mir festhalten um nicht hinzufallen. Ein Blick durch den Raum zeigte mir, dass alle diese Symptome aufwiesen. Irgendwas stimmt hier nicht. Meine Augen wurden immer schwerer und eine Müdigkeit übermannte mich. Mein Kopf schlug auf den Boden und alles war schwarz.
Das war nur ein Schicksal von 15.000 Menschen, die von 1941 bis 1945 in der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar getötet wurden. Der Gedanke der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ bestand schon seit 1920, als der Jurist Prof. Karl Binding und der Psychiater Dr. Alfred Hoche in ihrem Buch „Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form“ eine Diskussion über die Tötung sogenannter Erbkranker auslösten. Durch geschickte Propaganda gewann die NSDAP mehr Wähler und Mitglieder und wurde 1933 schließlich stärkste Partei im Reichstag. Nach der Machtübernahme wurden erbgesunde Familien von den Nationalsozialisten speziell gefördert und „Minderwertige“, wie Kranke, Behinderte, Kriminelle, Alkoholiker, Tuberkulosekranke und „Asoziale“ diskriminiert, ausgegrenzt, sterilisiert und verachtet. Bereits am 1. Januar 1934 trat das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft. Das Ziel der Nationalsozialisten unter Führung Adolf Hitlers war die Herstellung eines „rassenreinen“ und „rassentüchtigen“ Volkes. Die Vorbereitungen für die systematische Tötung von „lebensunwertem Leben“ begannen im Sommer 1939. Hier beauftragt Adolf Hitler mit einem Schreiben vom 1. September 1939 die „Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt unter Verantwortung, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann“. Die zu den „minderwertigen Gruppen“ zählenden Menschen wurden in der ersten Mordphase der T4- Aktion von Januar 1941 bis August 1941 durch das tödliche Gas Kohlenmonoxid in Gaskammern ermordet. Nach einer schnellen Untersuchung zur Feststellung einer passenden Todesursache für die Sterbeurkunde führte man bis zu 90 Menschen angeblich zum Duschen in die Gaskammer in den Keller. Danach wurden sie über die sogenannte Schleifbahn von der Gaskammer in die beiden Verbrennungsöfen gezogen und dort verbrannt. In Hadamar wurden in der ersten Mordphase ca. 10.000 „minderwertige Menschen“ umgebracht. Nach einer Predigt des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen, der die Euthanasieaktion öffentlich als Mord bezeichnet hatte, ließ Hitler am 24. August 1941 die Gasmorde einstellen. Allerdings war dies nicht das Ende der Euthanasiemorde. Ab August 1942 wurden „minderwertige Menschen“ mit der Verabreichung von überdosierten Medikamenten in Tablettenform und Spritzen getötet. In dieser zweiten Mordphase von August 1942 bis März 1945 starben nochmals ca. 4500 Menschen. In den letzten Jahrzehnten wurden in Deutschland bereits die Grundsteine dafür gelegt, dass auch zukünftig an die Gräueltaten des Nationalsozialismus gedacht wird und die Erinnerung daran nicht verblasst. Neben den Gedenkstätten als historische Orte, die die Gedenkkultur wesentlich prägen, tragen sowohl die Medien in Deutschland als auch der Geschichtsunterricht an den Schulen dazu bei, dass man sich auch zukünftig erinnert und, dass vor allen Dingen fundiertes Wissen über die Zeit des Nationalsozialismus vermittelt wird, denn Gedenken braucht Wissen. Auch der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar, der in Deutschland seit 1996 ein gesetzlich verankerter Gedenktag ist, hält die Erinnerung wach. Die Erinnerungs- und Gedenkkultur steht heute jedoch vor neuen Herausforderungen, da die Zeitzeugen des Nationalsozialismus, die bisher wichtig bei der Vermittlung des Geschehen an die nachfolgenden Generationen waren, sterben. Sie hinterlassen jedoch unzählige Zeugnisse in Form von Büchern, Filmen oder Tonbändern, sodass auch zukünftig Wissen vermittelt werden kann und so ein Erinnern möglich ist. Sowohl die Politiker in Deutschland als auch die Medien und die Schulen werden ihr Übriges dafür tun. Dies ist ein Aufruf an alle: Lasst uns dieses Wissen nutzen, uns erinnern und gemeinsam dafür sorgen, dass so etwas Grausames nicht noch einmal passiert. Lernen wir aus den Fehlern unserer Vorfahren.
Quelle: Die Euthanasiegedenkstätte Hadamar – Materialsammlung
Text: Alexandra Busch, Johanna Becker, Josephin Gruber, Nicola Busch und Merle Schönberger (Klasse 9a)
Von-Bodelschwingh-Straße 35, 56410 Montabaur
Telefon: +49 2602 15800, Fax: +49 2602 158010
eMail Schulleitung